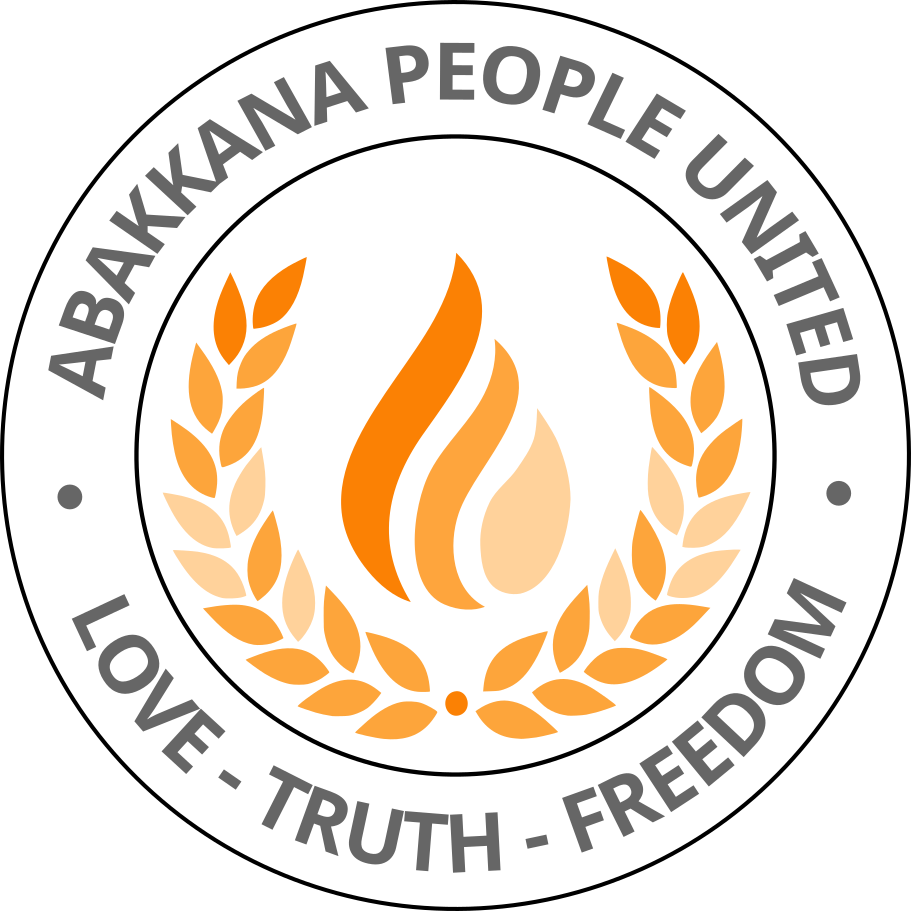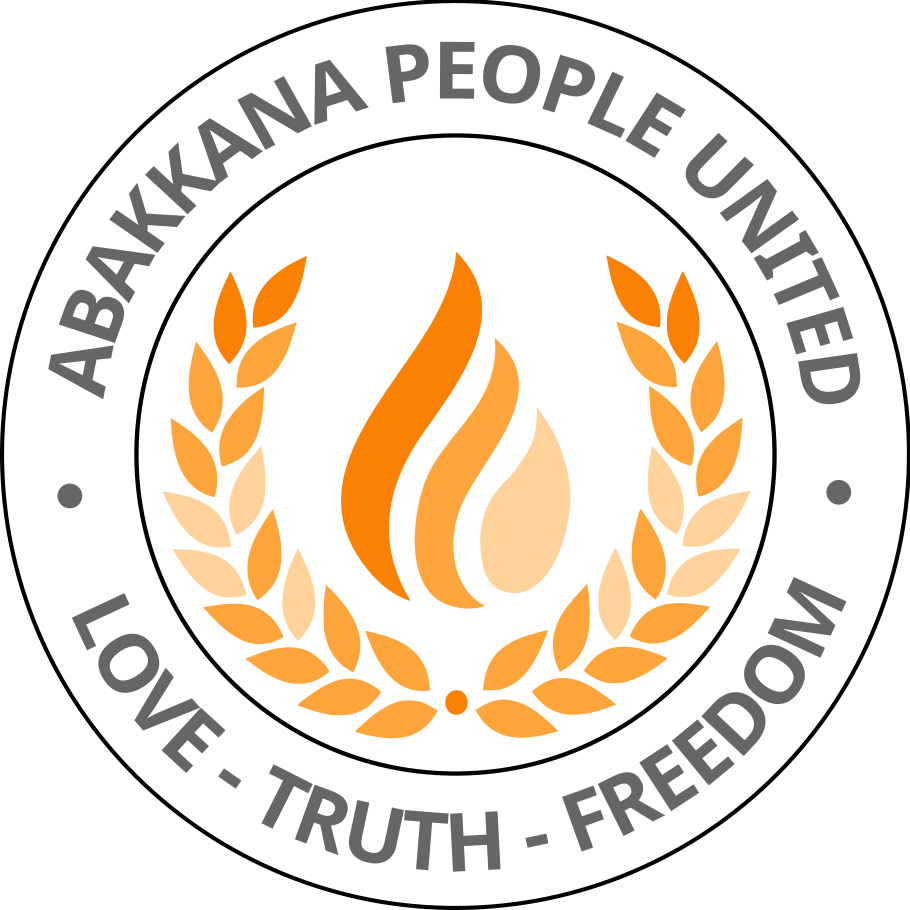Fast überall gibt es Gerüchte und Spekulationen. In der Kaffeeküche werden Neuigkeiten ausgetauscht und Geschichten weitererzählt – egal, wie viel Wahrheit darin steckt.
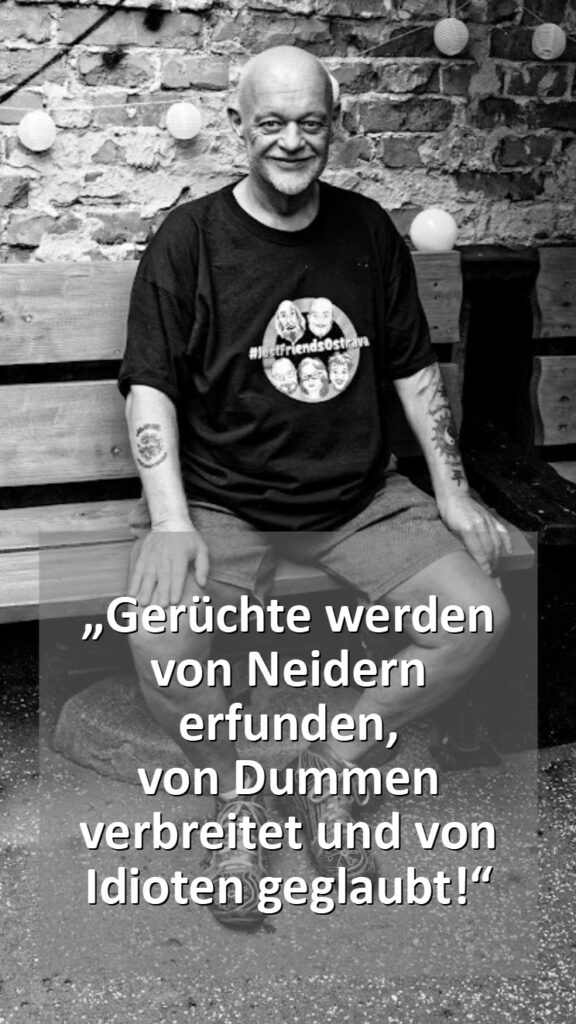
Hinweis:
„Als aktiver Menschenrechtsverteidiger und bekennender Pazifist beobachte ich solche Fälle vollkommen neutral und halte mich an den Rechtsgrundsatz der Unschuldsvermutung, bis ein unabhängiger und unparteiischer Richter ein Urteil nach Allgemeinem Völkerrecht gesprochen hat!“
Bernd M. Schmid
Pazifist & Menschenrechtsverteidiger
________________________________
Aber was sind Gerüchte und warum entstehen Sie?
Was ist ein Gerücht?
Gerüchte sind unbestätigte Informationen, Vermutungen, Spekulationen und Geschichten ohne genaue Hintergründe, die in sozialen Gruppen trotzdem weitererzählt werden. Manches hat einen wahren Kern, anderes ist frei erfunden oder ergänzt.
Viele Gerüchte richten sich gezielt gegen Aussagen, Handlungen oder Entscheidungen einzelner Menschen oder Gruppen. Sie sind nicht einfach nur spannender Smalltalk, sondern Teil von Intrigen, Indiskretion, Machtspielen oder auch Mobbing am Arbeitsplatz.
Bedeutung und Herkunft
Gerücht stammt vom Mittelniederdeutschen „geruchte“ = Geschrei oder Gerufe. Der Begriff „Klatsch“ (Klatsch und Tratsch) ist das lautmalerischer Geräusch des Ausschlagens nasser Kleidung an öffentlichen Waschplätzen. Dort kamen Frauen zusammen, wuschen Schmutzwäsche und tauschten Neuigkeiten aus.
Warum entstehen Gerüchte?
Gerüchte entstehen nicht grundlos, sondern oftmals aus Neugier und dem Wunsch, spannende Nachrichten zu verbreiten – der Wahrheitsgehalt spielt nur eine untergeordnete Rolle.
Aber welche Ursachen stehen hinter den Gerüchten?
Für die Entstehung gibt es zahlreiche Gründe und Möglichkeiten:
Fehlende Informationen:
Unklarheiten und fehlende Informationen führen zu Gerüchten. Der Publizist Cyril Northcote Parkinson sagte dazu: „Wo immer in der Kommunikation ein Vakuum entsteht, werden Gift, Müll und Unrat hineingeworfen.“
Wo es kein Wissen gibt, folgen Spekulationen.
Starke Vereinfachung:
Komplexe Themen und Zusammmenhänge werden in Gerüchten stark vereinfacht wiedergegeben. Das führt dazu, dass einige Teile weggelassen werden oder wichtige Inhalte verloren gehen. Plötzlich werden vereinfachte Geschichten erzählt, die in der Form gar nicht stimmen.
Falsche Wahrnehmung:
Die eigene Perspektive entspricht nicht immer der Wahrheit. Eine falsch interpretierte Aussage, ein Missverständnis oder eine Situation, die nicht vollständig beobachtet wurde – schon entstehen Gerüchte.
Spannende Übertreibung:
Wer wenig zu erzählen hat, übertreibt oder ergänzt spannende Details, um mehr Aufmerksamkeit und Beachtung zu bekommen.
Gezielte Manipulation:
Leider sind Gerüchte teilweise ein absichtliches Mittel der Manipulation. Gerade im Berufsleben soll die Spekulation unliebsamen Kollegen schaden und einen eigenen Vorteil bringen.
Welche Gerüchte werden verbreitet?
Nicht jede Spekulation verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Für erfolgreiche Gerüchte gibt es mehrere Faktoren:
Einfache Gerüchte
Die Geschichte muss so einfach sein, dass wir sie sofort und nur zu gerne glauben. Umständliche und schwer zugängliche Gerüchte verpuffen.
Emotionale Gerüchte
Eine gute Story berührt die Emotionen – Angst, Wut, Frust oder auch Hoffnung sorgen dafür, dass Klatsch und Tratsch weitererzählt werden.
Überraschende Gerüchte
Es braucht eine überraschende und neue Botschaft. Motto: „Hast du schon gehört, dass…“ Erst diese echte Neuigkeit macht Gerüchte spannend.
Realistische Gerüchte
Das Gerücht muss glaubwürdig und wahrscheinlich sein. Völlig abgedrehte Vermutungen, die wir uns im Traum nicht vorstellen können, sind wirkungslos.
Studien zeigen zudem:
Männer und Frauen tratschen gleich viel, aber über andere Themen. Frauen reden über Freunde, Familie und Aussehen. Männer sprechen über Besitz, Sport oder Transfergerüchte – und sind dabei deutlich emotionsloser.
Psychologie der Gerüchte
Gerüchte sind tief in der Psychologie von Menschen verankert. Die Lust am Klatsch und Tratsch gilt sogar als angeboren. Das Teilen und Erzählen von Spekulationen hat gleich mehrere psychologische Effekte:
Zugehörigkeit:
Durch Gerüchte entsteht ein Gefühl der Zugehörigkeit zur sozialen Gruppe – innerhalb der Kollegen oder Freunde. Der Tratsch schafft eine Form von Gemeinschaft unter den Beteiligten. Auf der anderen Seite werden andere ausgeschlossen.
Überlegenheit:
Das Schlechtreden anderer Menschen ist Balsam für die eigene Seele. Es gibt ein Gefühl von Überlegenheit und eigene Probleme sind eine geringere Belastung. Verstärkt wird dies durch den (empfundenen) Wissensvorsprung durch die spannende Neuigkeit.
Selbstschutz:
Wer Gerüchte über seine Mitmenschen teilt und verbreitet, ist selbst gerade nicht das Gesprächsthema. Es ist ein Ablenkungsmanöver zum Selbstschutz.
Frustabbau:
Gerüchte funktionieren wie ein Ventil für negative Emotionen. Das Weitererzählen negativer Geschichten baut Frust, Ärger und auch Agggressionen ab. Verbal zeigen Sie Ihre böse und aggressive Seite und fühlen sich anschließend besser.
Die Gerüchteküche offenbart zudem die Wertvorstellungen. Fehlverhalten und Aussagen von anderen werden gemeinsam (meist negativ) bewertet. Das zeigt, wer ähnlichen Ansichten teilt und stärkt das Vertrauen in der Gruppe.
Klare Empfehlung:
Halte Dich weitgehend aus Gerüchten und dem Flurfunk raus. Gerüchte werden von Neidern erfunden, von Dummen verbreitet und von Idioten geglaubt – damit wollen Sie möglichst wenig zu tun haben.
Willst Du trotzdem mitreden und in der Gerüchteküche den Kochlöffel schwingen, sollte der Klatsch beiläufig oder sogar positiv sein. Ansonsten gilt:
Quellen prüfen:
Lerne, verlässliche Quellen von schädlichen zu unterscheiden. Wer schwätzt nur belangloses Zeug? Wer ist tatsächlich gut verdrahtet und frühzeitig informiert? Meide die erste Gruppe und versorge Letztere mit guten eigenen Informationen.
Multiplikatoren erkennen:
Identifiziere die Flüstertüten und bringe diese in eine Reihenfolge, sortiert nach Themen, Wahrheitsgehalt oder Durchlaufgeschwindigkeit.
Nachrichten filtern:
Filtere gute von schlechten Nachrichten und gebe nur die positiven weiter – das verbessert auch Deinen Ruf. Idealerweise verifiziere die Informationen noch. Dann ist es kein Gerücht mehr, sondern eine echte Nachricht.
Schweigen können:
Du hörst Gerüchte und ein Kollege erzählt Dir aufgeregt den neuesten Tratsch. Rede nicht gleich mit, sondern höre nur schweigend zu. Sammle Informationen, die Du später kontrollieren und nutzen kannst. Das funktioniert, obwohl Du Dich selbst gar nicht aktiv beteiligst.
Fazit:
Um Dir Deine eigene Meinung zu bilden, denke dabei immer auch an die „Drei Siebe von Sokrates“ und wende das „TRIVIUM“ an.
________________________________
Schließe Dich unserer Friedensmission an!